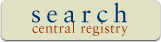News:
"Wir machen uns auch angreifbar" - "We're also vulnerable"
Brigitta Niederhauser und Alexander Sury
Noch 2014 stellte sich das Kunstmuseum Bern dezidiert auf den Standpunkt, dass es seine Hausaufgaben bezüglich Provenienzforschung gemacht habe. Dann kam Gurlitt – und plötzlich ist alles anders. War das Erbe der Auslöser für die jetzige Ausstellung?
 Kurator Daniel Spanke vor einem Picasso, einem Modigliani und einem Matisse (v.?l.?n.?r.), die alle in der Ausstellung «Moderne Meister» vorkommen.
Kurator Daniel Spanke vor einem Picasso, einem Modigliani und einem Matisse (v.?l.?n.?r.), die alle in der Ausstellung «Moderne Meister» vorkommen.
Einerseits sicher. Andererseits gab es noch einen weiteren Grund. Die ausländische Presse hat sich darüber gewundert, warum ausgerechnet das Berner Kunstmuseum als Erbin der Sammlung auserkoren wurde. Anscheinend existierte es auf der Karte der internationalen Museumslandschaft gar nicht.
Das hat Sie geärgert?
Eher erstaunt. Man kannte offensichtlich unser Haus nicht, obwohl die Sammlung den internationalen Vergleich nicht zu scheuen braucht. Vor diesem Hintergrund entschieden wir, uns einmal mit unseren eigenen Werkbeständen auseinanderzusetzen. Das Gurlitt-Erbe wird sich in eine lange Geschichte von Legaten einreihen, ohne die das Museum nicht zu dem geworden wäre, das es heute ist. Und da ist es sinnvoll, dass wir uns jetzt schon mit unseren eigenen Schätzen und der Frage auseinandersetzen, warum wir sieben Werke in Bern haben, die bis 1937 in deutschen Museen hingen.
Aber mit der eigenen Sammlung beschäftigt man sich doch andauernd . . .
. . . das stimmt schon, aber im Zentrum steht jetzt eine konkrete Fragestellung. Gurlitt ist ein Sensibilisierungsfaktor, aber auch ohne eine Sammlung Gurlitt müsste heute jedes Museum die Erwerbsgeschichten aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 untersuchen.
Wie sieht die Bilanz aus?
Was die Lücken anbelangt, ist die Bilanz ziemlich ernüchternd: Bei 337 von den 525 Werken, die nach 1933 ins Haus gekommen und vor 1945 entstanden sind, gibt es Lücken. Bei 37 Werken besteht insofern Handlungsbedarf, als dass wir über die Erwerbsgeschichte gar nichts wissen. Heute würde man solche Werke wohl nicht mehr ins Haus nehmen. Und dann gilt es noch zu unterscheiden, was «entartete» Kunst ist und welche Kunst bei all den Aktionen beschlagnahmt wurde, die das Deutsche Reich durchführte, als es alle Museen gleichschaltete. Schon 1930 liess ein nationalsozialistischer Kulturminister, der im Land Thüringen in der Regierung sass, Kunstwerke aus Museen entfernen. Damit fing in Deutschland die staatliche «Entsammlung» an. Bereits 1933 gab es erste «Schandausstellungen», und das Ziel war ganz klar: Die künstlerische Moderne sollte der Öffentlichkeit entzogen und zerstört werden.
Die meisten Bilder, die näher abgeklärt werden müssen, hat das Kunstmuseum nicht selber erworben, es sind Leihgaben. Waren die Stiftungsräte der Sammlungen Rupf und Othmar Huber einverstanden, dass auch die Herkunft dieser Werke genauer untersucht wird?
Da gab es keinen Widerstand. Wir haben mit allen Stiftungen und Depositären über unser Vorhaben gesprochen. Sie waren alle der Meinung, dass dies eine wichtige Aufgabe sei, die das Museum wahrnehmen müsse.
Die Zeichen der Zeit sind also auch bei den Sammlern erkannt worden?
Ja, und es war ja auch spannend zu untersuchen, wie sich Sammler damals verhalten haben. Das Ehepaar Margrit und Hermann Rupf hatte eine sehr differenzierte Haltung und machte sich Gedanken darüber, ob man an der Auktion «Moderner Meister aus deutschen Museen», die im August 1939 in der Galerie Fischer in Luzern durchgeführt wurde, überhaupt mitbieten solle. Rupfs versuchten auch, sich mit anderen Bietern abzusprechen, um so zu verhindern, dass das Regime gross von der Auktion profitiert.
Ein Sammler wie der Augenarzt Othmar Huber war pragmatischer.
Auch diese Haltung ist nachvollziehbar. Die Auktion in Luzern war für Sammler eine einmalige Chance, um an Werke heranzukommen, die sonst nie auf dem Markt sind. Die Galerie Fischer war privilegiert und ein wichtiger Umschlagplatz für Kunstwerke aus Deutschland. Sie verkaufte nicht nur Bilder an Auktionen, sondern auch im freien Verkauf. Und sie hatte neben Werken aus deutschen Museen auch solche aus Nachlässen von Sammlern im Sortiment, die rassisch verfolgt waren. Das ist dann NS-Raubkunst.
Dann müssen Sie also damit rechnen, dass Werke aus dem Berner Kunstmuseum als Raubkunst identifiziert werden?
Ja, das ist nicht ausgeschlossen.
Und wird es so weit kommen, dass es Restitutionsfälle gibt?
Es gibt zum Beispiel ein Werk, bei dem sich Verdachtsmomente ergeben haben. Es handelt sich um Ernst Ludwig Kirchners «Dünen und Meer», ein Bild, das möglicherweise als Leihgabe eines rassistisch Verfolgten in der Kunsthalle Bremen war und dort beschlagnahmt wurde. Über seine Erwerbsgeschichte, auch jener von nach 1945, wissen wir heute viel mehr. Es ist noch nicht so, dass wir sie lückenlos nachweisen können. Vieles widerspricht sich. An diesem Werk aber können wir exemplarisch zeigen, wie kompliziert Provenienzforschung sein kann, es gibt nämlich auf der Rückseite des Werks auch noch einen sächsischen Zollstempel.
Was passiert, wenn herauskommt, dass Raubkunst im Museum ist?
Das kann ich nicht sagen, da müsste der Stiftungsrat des Kunstmuseums entscheiden. Wenn sie mich als Kunsthistoriker fragen, so kann man ein solches Werk gar nicht mehr anfassen. Ich hätte damit ein moralisches Problem. In solchen Fällen müssen unbedingt faire und gerechte Lösungen gefunden werden.
Und wenn die Depositäre nicht Hand böten, das Bild zurückzugeben?
All diese Fragen muss der Stiftungsrat beantworten. Aber so wie ich die Depositäre kennen gelernt habe, schätze ich sie so ein, dass sie durchaus bereit wären, nach einer Lösung im Sinne der Verfolgten zu suchen.
In der Ausstellung zeigen Sie nun 70 Werke von Franz Marc über Picasso, Matisse, Cézanne bis zu Modigliani und Klee. Was waren die Kriterien bei der Auswahl?
Ausgewählt wurden besonders repräsentative Werke. Wir wollen vor allem die verschiedenen Arten der Erwerbung sichtbar machen. Natürlich spielten auch ästhetische Kriterien eine Rolle. Sehr gerne würden wir mehr zeigen, aber wir haben nicht den Platz dazu. So haben wir zum Beispiel die Druckgrafiken ganz ausgeklammert. Auf diesem Gebiet Provenienzforschung zu betreiben, ist fast unmöglich, da es immer mehrere Abzüge gibt. Wir wollen mit der Ausstellung nachvollziehbar machen, wie ein Kunstwerk ins Museum gelangt ist. Darüber macht man sich ja als Besucher kaum Gedanken, dabei ist es sehr spannend.
Darum also auch die unübliche Hängung?
Wir haben die Bilder nach Eingang in die Sammlung gehängt. Da gibt es immer einen Stichtag. Der Weg zu diesem Tag ist aber lang: Erst kommt bei einem Sammler die Idee auf, seine Schätze der Öffentlichkeit zu zeigen. Er gründet eine Stiftung, macht einen Vertrag mit dem Museum. Ab einem bestimmten Tag an ist dann das Museum für die Werke verantwortlich. Vor diesem Hintergrund ist die Provenienzgeschichte immer eine Geschichte der Eigentümer.
Die Herkunft aller 525 Werke zu dokumentieren, ist ein Riesenprojekt. Wie schafft man das?
Wir stehen erst ganz am Anfang. Die Forschungsarbeit ist ziemlich aufwendig, und wir haben uns erst einmal auf die Quellen in unserem Haus konzentriert. Sie sind lückenhaft und widersprechen sich teilweise. Aber wir verfügen über alte Inventarkarten und Dokumente, die gar nicht so schlecht sind.
Wie gestaltete sich die Kooperation mit Kunsthändlern und Galeristen, die über Archive zu jenem Zeitraum verfügen?
Unterschiedlich, in Bern hatten wir mit den Kunsthändlern Kornfeld und Ketterer sehr guten Kontakt. Aber immerhin fand in der Schweiz keine flächendeckende Zerstörung wie in Deutschland statt.
Das Kunstmuseum ist mit seinem Vorhaben vorgeprescht. Haben die anderen Museen darauf reagiert?
Wir haben nicht um Erlaubnis gebeten. Wenn andere uns folgen, ist das zu begrüssen. Wir vernetzen uns diesbezüglich auch gerne. Denn so etwas kann man allein gar nicht bewältigen. Uns ist wichtig, die Hausaufgaben zu machen und Transparenz zu schaffen. Ob wir das überhaupt machen sollen, haben wir intensiv diskutiert, denn wir setzen uns einer bestimmten Gefahr aus.
Welcher denn?
Man kann uns vorwerfen, dass bezüglich Provenienzforschung bisher nur wenig unternommen wurde. Da machen wir uns auch angreifbar. Aber wir betreiben eine Forschung, die es vor zehn Jahren noch nicht gab, weil diese Fragen noch nicht gestellt wurden.
Auch das Bundesamt für Kultur hat einen Gesinnungswandel durchgemacht. Es war ja zuerst überhaupt nicht begeistert, dass Bern das Erbe Gurlitt angenommen hat, weil es Folgen für andere Museen fürchtete. Bekommen Sie Unterstützung?
Das Bundesamt für Kultur unterstützt unsere Ausstellung mit einem substanziellen Beitrag. Und wir können noch Gesuche für Beiträge an die fundierte Untersuchung von einzelnen Bildern stellen. Im Moment ist noch nicht definiert, welche Werke das sein werden.
Sie sind Deutscher und betrachten diese Provenienzforschung aus einer besonderen Perspektive. Was waren Ihre Erwartungen und was hat Sie überrascht?
Bei der Lektüre der Originalquellen sind wir auf sehr bedrückende Geschichten gestossen. Da spielt meine Herkunft schon eine Rolle, weil ich wohl sensibler bin bei bestimmten Dingen. Aber wir beschäftigen uns im Rahmen der Ausstellung auch mit der Geistigen Landesverteidigung in der Schweiz während der NS-Zeit. Man förderte eine bestimmte nationale konservative Kunst. Die Schweiz hat aber im Unterschied zum NS-Regime nie die Vielfalt der Kunst per Gesetz offiziell eingeschränkt. Ich habe mir die Landi von 1939 genau angeschaut, da ist mir eine unglaubliche ästhetische Vielfalt aufgefallen.
Das Kunstmuseum Bern war in dieser Zeit in seiner Ankaufspolitik traditionell ausgerichtet und hatte in der Kriegszeit gar den Ruf eines Rütli unter den Schweizer Museen.
Das ist so, aber es gibt Ausnahmen. Max Huggler war ja, ehe er 1944 die Leitung übernahm, Mitglied des Direktoriums und hat darauf hingewirkt, dass noch anderes gekauft wurde; diese Werke stechen denn auch richtig heraus. Aber es gab nicht wie in Basel diese mutigen Verfechter der Avantgarde. In Bern wurden die klassische Positionen gesammelt, immerhin auch ein Hodler – aber er war eben Berner.
Und Klee?
Das Museum hat in jener Zeit kein einziges Bild von Klee gekauft. «Ad Parnassum» wurde von den Freunden des Kunstmuseums erworben. Der unbestrittene Meister Klee ist ein Produkt der Nachkriegszeit. Man war eben in Bern sehr konservativ. Das war legitim, denn die andere Seite, die Moderne, wurde ja nicht unterdrückt. Die Geistige Landesverteidigung war nicht eine Anti-Moderne, sondern eine Nicht-Moderne. Das ist der Unterschied.
___
Daniel Spanke
Kurator
Im Oktober 2012 als Ausstellungskurator im Bereich der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts gewählt, hat der 50-jährige Daniel Spanke seither im Kunstmuseum Bern unter anderem Ausstellungen zu Germaine Richier und Max Gubler sowie die thematische Schau «Stein aus Licht» ausgerichtet. Der berufliche Weg führte ihn von der Kunsthalle Emden (2000–2002) zur Leitung der Kunsthalle Wilhelmshaven. Ab 2006 war er Kurator für Klassische Moderne am Kunstmuseum Stuttgart und Leiter Museum Haus Dix (2010–2012). Die von Daniel Spanke kuratierte Ausstellung «Moderne Meister. ‹Entartete› Kunst im Kunstmuseum Bern» wird am 6. April eröffnet und dauert bis zum 21. August.