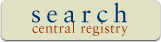News:
München leuchtet alles aus - Munich illuminates everything
von Patrick Bahners und Julia Voss
Die Forschung macht solche Fortschritte, dass auch der Verantwortungsbegriff der Museen sich ändert: Der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen erklärt, was die Pinakotheken beim Thema Raubkunst tun.

„Das Zitronenscheibchen“ von Jacob Ochtervelt, aus der Bayerischen Staatsgemäldesammlung.
Sie sind seit anderthalb Jahren in München. Nun stehen Sie mitten in einer erregten öffentlichen Diskussion, in der Ihren Vorgängern Hehlerei zugunsten von Kriegsverbrecherfamilien und Ihnen und Ihren Mitarbeitern Verdunkelung vorgeworfen wird. Haben Sie unterschätzt, welche Herausforderung Sie beim Thema Raubkunst erwartete?
Ich habe gewusst, dass es in München Probleme gibt, die mit der Übertragung von Eigentum im 20. Jahrhundert zu tun haben. Nicht geahnt habe ich, dass es um eine so große Stückzahl geht. Ich habe vielleicht auch nicht genau genug gewusst, was es um „Das Zitronenscheibchen“ von Jacob Ochtervelt für Bataillen gegeben hat.
In Dresden, wo Sie vorher waren, gibt es das Daphne-Projekt, das international einen guten Ruf genießt. Sind die Münchner bei der Provenienzrecherche personell schlechter aufgestellt?
Dresden hat mehr als 1,5 Millionen Objekte, München hat 25.000 Gemälde und 12.000 Fotografien. Dazu muss man die Personalzahlen in Beziehung setzen. Wir sind das deutsche Museum, das in der Provenienzforschung neben Dresden die meiste Manpower aktiv eingesetzt hat. Daphne ist auch ein Gesamtinventarisationsprogramm. In München ist seit 2008 Andrea Bambi als Provenienzforscherin tätig. Außerdem haben wir jetzt drei weitere Personen für Provenienzen und Sammlungsgeschichte. Und wir werden absehbar eine weitere Stelle aufstocken.
Absehbar heißt?
Die Stellenausschreibung wird gerade vorbereitet. Wir werden eine fünfte Person ins Haus holen. Hoffentlich finden wir sie. Die Nachfrage nach qualifizierten Provenienzforscherinnen und -forschern ist sehr groß. Gott sei Dank.
Soll heißen: Endlich?
Wir müssen ganz klar an den Anfang jeder Überlegung das Bedauern darüber stellen, dass über Jahrzehnte dieses Thema aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein weggerückt worden ist und daher auch die Museen nicht mehr beschäftigt hat. Man hat in den sechziger Jahren das Gefühl gewonnen und das Bewusstsein gepflegt, dass die Dinge geradegezogen seien. In der Tat waren ja bis dahin viele Restitutionen abgewickelt worden. Übriggeblieben sind oft nur die Fälle, die man nicht lösen konnte oder die man nicht erkannt hat. Auch deshalb, weil die Gesellschaft eine Schlussstrichdebatte suchte.
Heute wird nun eine Seilschaftdebatte geführt. Für Aufregung sorgten zuletzt Verkäufe aus dem Bestand nachkriegsbedingter Zugänge, die bis in die siebziger Jahre hinein weitergingen. Auch Familienangehörige von Nazi-Größen tätigten Käufe zu geringen Preisen.
Aus den Akten möchte ich dazu etwas exemplarisch zitieren: „Dass die Angaben der Frau von Schirach nicht zuverlässig sind“, schrieb 1949 Eberhard Hanfstaengl, der Generaldirektor von 1945 bis 1953. „Es wurden weitere Stücke einstweilen im Depot zurückgehalten. Frau von Schirach wurde davon verständigt und gebeten, die notwendigen Unterlagen über den Erwerb hier vorzulegen.“ Man bezweifelte also, dass sie die Kunstwerke, deren Herausgabe sie verlangte, wirklich schon vor 1933 erworben hatte. Hanfstaengl hat sich bemüht, solche Forderungen abzuwehren, musste aber in einzelnen Fällen dem Druck aus den Ministerien und der Finanzbehörde nachgeben. Als nachgeordnete Behörde haben die Staatsgemäldesammlungen eigentumsrelevante Dinge nicht final entschieden.
Wer entscheidet heute?
Heute erörtern wir die Dinge gemeinsam mit dem Kunstministerium. Auf der Grundlage von Erkenntnissen darüber, wie viele Fehler man machen kann, kommt es zu ganz anderen Gesprächen. Mir ist für München wichtig, dass wir mit den Antragstellern an einen Tisch gehen. Wir müssen reden. Auf Vermutungen hin kann der Freistaat nichts herausgeben. Es braucht Klarheit, weil man ja anderenfalls Gefahr läuft, dass sich ein anderer Antragsteller meldet und eine Fehlherausgabe geltend macht. Diese Komplexität ist entstanden durch die hochdifferenzierten Fortschritte der Recherche.
Forschung kann im Einzelfall demnach Restitutionen auch erschweren.
Noch in den achtziger Jahren galt der gesamte Komplex als abgeschlossenes Kapitel. Erst durch die Washingtoner Konferenz 1998 ist er wieder in den Blick gerückt. In München hat man sehr schnell nach 1998 Ilse von zur Mühlen für die Aufarbeitung der Sammlung Hermann Görings gewonnen. Aus heutiger Sicht muss man beklagen, dass nach dem Erscheinen ihres Buchs nicht umgehend das nächste Projekt angesetzt wurde. Trotzdem ist vieles Richtige gemacht worden: Wir haben Fälle geklärt, Restitutionen gemacht, sind bei der Limbach-Kommission gewesen. Das ist im öffentlichen Gedächtnis vielleicht nicht so stark verankert, wie diese Leistungen es verdient hätten. 2013 ist hier das Projekt zu den „Überweisungen aus Staatsbesitz“ begonnen worden.
Die treuhänderische Übergabe der bei NS-Funktionären beschlagnahmten Kunstgegenstände an Bayern erfolgte 1948 seitens der Amerikaner mit der Maßgabe, dass die Nachforschungen über die Herkunft fortzusetzen seien. Trotzdem sind, wie Kunstminister Spaenle unlängst feststellte, solche Forschungen damals nicht mehr erfolgt. Ihr Vorgänger Eberhard Hanfstaengl hatte 1950 erklärt, sie seien nicht mehr sinnvoll, da die Amerikaner schon alle Quellen ausgeschöpft hätten. Wie bewerten Sie Hanfstaengls Rolle bei dieser kulturpolitischen Weichenstellung?

Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Bernhard Maaz.
Das Vorhandensein unseres auf mehrere Jahre angelegten Projekts beantwortet Ihre Frage. Wir erforschen seit 2013 diese heute befremdenden Entscheidungen, die ihnen zugrundeliegenden Haltungen, die Einstellungen von Entscheidungsträgern der Nachkriegsgesellschaft und somit auch der mit den Überweisungen befassten Generationen von Direktoren. Die Studie wird die Handlungsspielräume der damaligen Verantwortlichen auch in Ministerien und Politik untersuchen. Insbesondere soll sie klären, welche ambivalente Rolle eine etwaige Loyalität gegenüber Protagonisten des NS-Regimes spielte. Erst nach dieser überfälligen wissenschaftlichen Aufarbeitung ist eine faktenbasierte Wertung der Rolle Hanfstaengls – auch er war während der NS-Zeit amtsenthoben worden – möglich.
Gleichwohl stellen Sie heute schon fest, dass einige der damaligen Entscheidungen befremden. Wie ist es vor diesem Hintergrund um die moralische Grundlage des Verbleibs der „aus Staatsbesitz“ überwiesenen Kunstwerke in Ihren Sammlungen bestellt?
Er ermöglicht, dass wir nach erfolgter Recherche der Provenienzen im günstigsten Fall von dort stammende Werke restituieren können. Was zu unternehmen ist, wenn sich nach erfolgter Recherche zu den Werken kein Raubkunstverdacht ergibt oder nicht klären lässt, ist eine Frage, die sicher auch noch auf politischen Ebene zu diskutieren wäre - dann auch mit Blick auf vergleichbare Bestände, wie sie das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen verwaltet.
Wie die Auktionen zeigen, verfolgten Ihre Vorgänger nicht die Linie, dass im Zweifel alles Überwiesene in den Museen bleiben müsse.
Die Verkäufe betrafen das, was als nicht museumswürdig eingeschätzt wurde. Man wollte abgeben, was nie auszustellen war, um stattdessen Werke der Moderne zu kaufen, um sozusagen auf einem anderen Kanal Wiedergutmachung zu leisten – an den Sammlungen. Da gab es den Eros der Öffnung. Aber man darf nicht übersehen: Auch in dieser Weise zog man einen Schlussstrich.
Wie weit ist das Projekt zu den „Überweisungen“ gediehen?
Der zuständige Mitarbeiter, Florian Wimmer, ist im Sommer 2015 tragischerweise mit 32 Jahren verstorben. Wir mussten noch einmal neu anfangen. Wir haben die Stelle mit Johannes Gramlich besetzt, einem Zeithistoriker, was ich für sehr wichtig halte, weil wir nicht nur mit Kunstgeschichte als Sozialgeschichte oder Formgeschichte operieren können. Es geht um nahezu tausend Werke. Viele stammen aus der „Großen Deutschen Kunstausstellung“ und scheiden als Raubkunstverdachtsfälle aus. Die zweifelhaften Fälle werden bei der Datenbank „Lost Art“ eingestellt. Wir haben kürzlich die Möglichkeit ergriffen, die zwei befristeten Stellen bis 2020 zu verlängern. Auch das ist nicht selbstverständlich. Ich darf sogar sagen: Auch darauf bin ich stolz.
In welchem Tempo kommen Sie voran?
Beim Bund gibt es etwa zweitausend ähnliche Fälle. Daran arbeiten drei Wissenschaftler seit dreizehn Jahren. Dreizehn mal drei sind vierzig Mannjahre: Eine Person kann im Jahr, wenn es gut läuft, zwanzig problematische Provenienzen klären. Deswegen wird bei uns weiter aufgestockt, aber deswegen wird es auch noch einige Jahre dauern. Die Erwerbungen von 1933 an sind schon einmal geprüft worden, vor gut zehn Jahren. Die Provenienzforschung hat sich seither so radikal weiterentwickelt, dass wir dieselbe Arbeit auf einer tieferen Sondierungsebene noch einmal machen wollen. Auch unser Verantwortungsbegriff entwickelt sich weiter.
Ihre Bereitschaft zum Weiterforschen demonstrieren Sie auch dadurch, dass Sie die Arbeitsmaterialien im Haus behalten: Sie geben Ihre Akten nicht wie andere nachgeordnete Behörden an das Hauptstaatsarchiv ab. Was antworten Sie den Kritikern dieser Praxis, zu denen auch die Generaldirektorin der Staatlichen Archive Bayerns gehört?
Das Archiv der Staatsgemäldesammlungen ist unser Wissen und Gewissen. Auch andere große Museen archivieren ihre Akten selbst. Als ich in Dresden war, gab es dort eine Diskussion mit dem Innenministerium: Aus guten Gründen wurde das Archiv für die Kunstsammlungen erhalten, mit einer Archivarin und öffentlicher Benutzung. Das Thema Archiv begleitet mich durch mein Leben. Jetzt bin ich hier und sehe: Es gibt Akten in einer Vollständigkeit, die ein Glücksumstand ist. An ihnen wird geforscht, sie sind auch für externe Forscher jederzeit zugänglich.
Die öffentliche Zugänglichkeit ist aber nicht nur eine Frage der Öffnungszeiten, sondern auch des Personals.
Es ist nicht wahr, dass das Archiv unzugänglich war. Das hat sich festgesetzt, weil es gestreut worden ist, aber es trifft nicht zu. Derzeit ist mein Stellvertreter Martin Schawe als Leiter der Inventarabteilung für das Archiv verantwortlich, der sich bislang persönlich um Benutzungswünsche kümmerte. Ihr Satz ist trotzdem richtig: Wir werden absehbar die Stelle eines hauptamtlichen Archivars haben.
Was heißt absehbar?
Sie ist ausgeschrieben. Unser Ziel ist das bessere Arbeiten intern und extern, das bessere Erschließen. Es ist kein Zufall, dass das Bundesjustizministerium vor wenigen Wochen erst die Aufarbeitung seiner NS-Geschichte vorgelegt hat. Auch in anderen Struktureinheiten ist das heute dran. All das gehört zu einem Umdenken, das mit unserer Generation verbunden ist. Es hat mit Erfahrungen zu tun und kann mit Anschuldigungen nicht genährt werden. Im Gegenteil.
Ein Umdenken hat es auch in der Bundeskulturpolitik gegeben. In die Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter sind zwei jüdische Mitglieder berufen worden. Halten Sie die sogenannte Limbach-Kommission für eine sinnvolle Einrichtung?
Absolut. Das ist keine Antwort aus Loyalität, sondern aus Überzeugung. Die Bundesrepublik ist der Rechtsnachfolger des NS-Systems und muss für eine zentrale, übergeordnete Ebene ein Modell finden. Wir werden auch künftig Fälle haben, mit denen wir dort hingehen.
In zwei Fällen hat es Verwunderung ausgelöst, dass die Staatsgemäldesammlungen die Befassung der Limbach-Kommission abgelehnt haben: „Zitronenscheibchen“ und Picassos „Madame Soler“. Warum haben Sie diese Möglichkeit der Klärung nicht wahrgenommen?
Beide Fälle sind hochkomplex.
Deswegen gibt es ja die Kommission.
Beim „Zitronenscheibchen“ erkenne ich nicht, warum wir das tun sollten. Diese Geschichte war vor dem Stichdatum abgeschlossen. Die Familie hat den Antrag 1950 zurückgenommen.
Wenn die Kommission auch symbolisch eine so gute Sache ist, welche Gründe kann es dann aber für ein staatliches Museum geben, einen Schiedsspruch vermeiden zu wollen? Zumal in einem Fall, den Sie für eindeutig halten?
Ihre Rückfrage ist völlig legitim. Warum geht man, und warum geht man nicht hin? Die Rücknahme des Antrags 1950 erfolgte, weil es sich um die Sicherheit eines Darlehens gehandelt hatte, das vollumfänglich zurückgezahlt war. Das war der Punkt. Man wird Fälle haben, in denen solche Dinge nicht vorliegen. Wenn es in der Zeit, in der man ein ganz klares Auge darauf gehabt hat, die Klärung in Form einer Antragsrücknahme gab, würde ich die Kommission damit nicht befassen.
Doch wieso soll die Erklärung der damaligen Antragsteller diese Trumpfwirkung haben? Sollen die Washingtoner Prinzipien nicht Gerechtigkeit im Einzelfall jenseits der juristischen Verfahrensregeln der Nachkriegszeit ermöglichen?
Mir wäre daran gelegen, solche Fälle vor die Limbach-Kommission zu bringen, in denen es so ein Abschlussstatement nicht gibt – aus einer Zeit, für die wir auf einer Demokratie bestehen dürfen. 1950 können wir nicht anfechten. Wenn wir einen Verzicht von 1950 anfechten, dann haben wir bald alle Bilder bei der Limbach-Kommission. Wenn 1950 dieses Verfahren geschlossen worden ist, sollte man nicht das Gras wieder herunterfressen.
Das neue Kulturgutschutzgesetz legt den Händlern neue Sorgfaltspflichten auf, Cornelius Gurlitts Sammlung wurde ins Netz gestellt, einschließlich der Geschäftsbücher. Sind wir strenger mit Privatleuten als mit öffentlichen Museen?
Gurlitt war ein Einzelfall. Kein anderer Privatmann wurde zu ähnlichen Offenlegungen genötigt. Aber das andere ist: Wir arbeiten daran. Wir wollen unsere Sammlungen ins Netz stellen. Wir haben nur einfach ein bisschen mehr als Gurlitt, und das dauert ein bisschen länger.