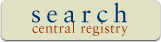News:
Verschleppt und versteckt - Adbucted and Hidden
Deutschlandfunk Kultur 8 December 2021
Von Sabine Adler
Im Zweiten Weltkrieg plünderten die Nationalsozialisten ukrainische Museen und schafften die geraubte Kunst auch nach Deutschland. Bis heute sind Tausende dieser Kunstwerke nicht wieder aufgetaucht. Ukrainische Museumsangestellte geben die Suche aber nicht auf.

Solche historischen Aufnahmen, wie hier das Panin-Bild im Ausstellungssaal 1929, helfen den Museumsmitarbeitern heute.



 https://www.deutschlandfunkkultur.de/verschleppt-und-versteckt-nazi-beutekunst-aus-der-ukraine-100.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/verschleppt-und-versteckt-nazi-beutekunst-aus-der-ukraine-100.html
Von Sabine Adler
Im Zweiten Weltkrieg plünderten die Nationalsozialisten ukrainische Museen und schafften die geraubte Kunst auch nach Deutschland. Bis heute sind Tausende dieser Kunstwerke nicht wieder aufgetaucht. Ukrainische Museumsangestellte geben die Suche aber nicht auf.

Restaurateurin Jelena Krawtschenko vor dem Panin-Bild von Zar „Iwan dem Schrecklichen“, das sich Jahrzehnte in den USA im Privatbesitz befand.
Durch ein gut gesichertes Tor, über zwei Hinterhöfe hinweg liegt die Zentrale Restaurationswerkstatt Kiew, versteckt in einem Flachbau, dem selbst eine Renovierung nottäte. Am Eingang versperrt ein riesiges Ölgemälde den Weg ins Atelier. Es ist dreieinhalb Meter lang und stößt mit seinen zweieinhalb Meter Höhe fast an die Decke.
Darauf der Zar Iwan Grosny. In Pelzmantel und Fellmütze auf einem kräftigen Schimmel. Reiter und Pferd traben mit gesenkten Köpfen durch einen Torbogen aus einer Festung in den Schnee hinaus. Bewaffnete Gestalten und Bettler blicken ihnen hinterher. Eine Kirche mit Zwiebeltürmen leuchtet fern im Abendrot. „Die heimliche Abreise von Iwan dem Schrecklichen vor der Oprichnina“ heißt das Bild. Gemalt von Michail Panin. Die Werkstattleiterin Swetlana Strelnikowa weist auf die Signatur.
„Das Bild war schmaler, wir fanden den Namen erst auf der Rückseite. Jemand hat die Leinwand so zusammengefaltet, dass sie in einen kleineren Rahmen passte.“
Das Ölgemälde hat eine Odyssee hinter sich. Bevor es in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ankam, war es zuerst in Sankt Petersburg, dann in Dneprpetrowsk und schließlich im US-amerikanischen Ridgefield im Bundesstaat Connecticut. Dort hatte das Ehepaar Gabby und David Tracy 1987 ein voll möbliertes Haus gekauft, samt Iwan dem Schrecklichen, das Bild, von dessen Geschichte sie 30 Jahre lang nichts wussten.
Das Ölgemälde hat eine Odyssee hinter sich. Bevor es in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ankam, war es zuerst in Sankt Petersburg, dann in Dneprpetrowsk und schließlich im US-amerikanischen Ridgefield im Bundesstaat Connecticut. Dort hatte das Ehepaar Gabby und David Tracy 1987 ein voll möbliertes Haus gekauft, samt Iwan dem Schrecklichen, das Bild, von dessen Geschichte sie 30 Jahre lang nichts wussten.
Eins von insgesamt 1002 gestohlenen Arbeiten
Als sie 2017 das Haus wieder komplett verkaufen wollten, zögerte die Auktionsfirma, denn das offensichtlich russische Gemälde sah verdächtig nach Raubkunst aus. Panin war kein unbekannter Maler, sondern Absolvent der Zarenkunstschule, der 1925 mit seinem Werk nach Dneprpetrowsk ging. Deshalb musste vor dem Verkauf die Herkunft des Gemäldes, Provenienz genannt, geklärt werden.
„2017 wurden wir per Mail von dem Auktionshaus, der Potomac Company in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia, gefragt, was wir über das Gemälde auf dem mitgeschickten Foto wüssten.“
Sagt Tetjana Schaparenko, die heute das Kunst-Museum in Dnipro, wie die Stadt heute heißt, leitet. So wie knapp 100 Jahre vor ihr der Maler Michail Panin. Dessen Zarengemälde hing in diesem Museum in der Stadt, bis die Nazis 1941 auf ihrem Ostfeldzug die Sowjetunion überfielen.
„Es ist eines unserer vermissten Bilder und befand sich von 1914 bis 1941 in unserem Museum. Und genau aus diesem Gebäude hier haben die Hitler-Leute über 1000 Gemälde rausgetragen. In solche Listen trugen die Okkupanten alles ein, was mit nach Deutschland gehen sollte. Unter der Nummer 417 steht das Zarenbild. Es ist eine der insgesamt 1002 gestohlenen Arbeiten.“
Auch dank der pedantischen Nazi-Bürokratie konnte die Direktorin Tetjana Schaparenko etliche Dokumente zusammentragen, die belegen, dass Panins „Iwan der Schreckliche“ ihrem Museum gehört.
Auch dank der pedantischen Nazi-Bürokratie konnte die Direktorin Tetjana Schaparenko etliche Dokumente zusammentragen, die belegen, dass Panins „Iwan der Schreckliche“ ihrem Museum gehört.
„Wir haben Fotos aus den 1920er-Jahren, auf denen der Ausstellungssaal voller Gemälde zu sehen ist, mit dem von Panin. Und die Inventarbücher von 1921 bis 1940, darin findet sich der Vermerk: ‚Gestohlen‘.“
Wie Detektive auf Spurensuche
Wie eine Detektivin sammelte Tetjana Schaparenko die Beweise, und inzwischen geht es längst nicht mehr nur um das Gemälde.
„Die US-Geheimdienste interessierten sich sofort für den Vorbesitzer des Bildes. Wir vermuten, mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit, dass es sich um den Brigadeführer Tatz handelt, der 1946 in die USA einreiste. Wie sich herausstellte unter falschem Namen. Man fand heraus, dass er ein deutscher Offizier war, der sich als Schweizer Grenzsoldat ausgab. Er hatte sich offenbar eine neue Identität zugelegt. Und die große Frage ist doch, wie ein Schweizer Grenzsoldat an ein Gemälde aus der Ukraine gerät?“
„Die US-Geheimdienste interessierten sich sofort für den Vorbesitzer des Bildes. Wir vermuten, mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit, dass es sich um den Brigadeführer Tatz handelt, der 1946 in die USA einreiste. Wie sich herausstellte unter falschem Namen. Man fand heraus, dass er ein deutscher Offizier war, der sich als Schweizer Grenzsoldat ausgab. Er hatte sich offenbar eine neue Identität zugelegt. Und die große Frage ist doch, wie ein Schweizer Grenzsoldat an ein Gemälde aus der Ukraine gerät?“
Jener ominöse Brigadeführer Tatz hat in dem Museum unübersehbare Spuren hinterlassen.
„In unserem Archiv fand sich eine Notiz vom 17. Juli 1942, in der steht: „Dem Brigadeführer Tatz wurden sieben Exponate ausgehändigt: eine Porzellanvase, eine Büste, einige Gemälde, unter anderem Panins ´Iwan der Schreckliche`. Diesen Zettel haben wir im Original. Er ist nicht das einzige Beispiel, mit welcher Akribie die Nazis ihre Entwendungen dokumentierten.“
„In unserem Archiv fand sich eine Notiz vom 17. Juli 1942, in der steht: „Dem Brigadeführer Tatz wurden sieben Exponate ausgehändigt: eine Porzellanvase, eine Büste, einige Gemälde, unter anderem Panins ´Iwan der Schreckliche`. Diesen Zettel haben wir im Original. Er ist nicht das einzige Beispiel, mit welcher Akribie die Nazis ihre Entwendungen dokumentierten.“

Solche historischen Aufnahmen, wie hier das Panin-Bild im Ausstellungssaal 1929, helfen den Museumsmitarbeitern heute.
Das Zettelchen auf Russisch sagt trotzdem noch nicht viel über den Kunsträuber Tatz aus. Auch sein Dienstrang „Brigadeführer“ lässt keinen sicheren Rückschluss darauf zu, welcher der vier rivalisierenden Kunstraubeinheiten der Nazis er angehörte. Sie alle machten von 1941 bis 1944 Jagd auf Kultur- und Kunstschätze in der Ukraine. Oder auf das, was deutsche Soldaten noch nicht zerstört, verwüstet oder geplündert hatten.
Auf Bilder, Bücher und andere Kulturgüter hatte es nicht nur der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg abgesehen, eine Rauborganisation der NSDAP. Auch die sogenannten „Kunstschutz“-Einheiten der Wehrmacht beschlagnahmten ganze Bibliotheken, in Dneprpetrowsk zum Beispiel die des Bergbau-Instituts oder in Kiew das sowjetische militärhistorische Archiv.
Neben Himmlers „Ahnenerbe“, dem dritten Raubtrupp, war auch noch das Sonderkommando Künsberg vom Auswärtigen Amt unterwegs, benannt nach seinem Leiter, SS-Sturmbannführer Baron Eberhard von Künsberg. Sie lieferten sich oft ein regelrechtes Rennen um die Schätze.
Restauration dauert mehr als ein Jahr
Brigadeführer Tatz, Dieb des Zarenbildes, dürfte längst gestorben sein. Die letzten Besitzer des Gemäldes, das Ehepaar Tracy, zögerte keinen Moment, das Kunstwerk freizugeben, unentgeltlich, wie es das US-Recht vorschreibt. Kein Problem für Gabby Tracy, die eine ungarische Holocaustüberlebende ist. Doch noch kann „Iwan der Schreckliche“ nicht zurück nach Dnipro. Erst wenn Jelena Krawtschenko in Kiew grünes Licht dafür gibt. Sie restaurierte über anderthalb Jahre das Bild.
„Wahrscheinlich hat es lange über einem Kamin oder einer Heizung gehangen. Die Farbschichten hatten sich verändert, außerdem hat jemand es ständig übermalt, wollte da was ausbessern. Völlig unprofessionell.“
Anfangs war sich die ukrainische Restaurateurin nicht sicher, ob es sich wirklich um ein Gemälde von Anfang des 20. Jahrhunderts handelte.
„Denn es gab drei Farbschichten auf dem Bild. Wir untersuchten es und es stimmt, es ist von 1911. Farben, Pigmente, Grundierung entsprechen dieser Zeit.“
„Denn es gab drei Farbschichten auf dem Bild. Wir untersuchten es und es stimmt, es ist von 1911. Farben, Pigmente, Grundierung entsprechen dieser Zeit.“
Bevor sie die fremden Farbschichten entfernte, machte sie Röntgenaufnahmen.
„So sah ich, wie weit die Schichten gehen, die der Künstler aufgetragen hatte, und was danach andere aufgepinselt haben. Die Farbgebung von diesen Laien war wirklich schlimm.“
Wenn jetzt der Lack trocken ist, soll das von den Nazis geraubte Werk zuerst der Kiewer Kunstwelt präsentiert werden, dann darf es nach Dnipro zurück. 79 Jahre später. Das erste und bisher einzige von über 1000 Gemälden aus dem Dniproer Museum, die von den Deutschen gestohlen wurden.
„So sah ich, wie weit die Schichten gehen, die der Künstler aufgetragen hatte, und was danach andere aufgepinselt haben. Die Farbgebung von diesen Laien war wirklich schlimm.“
Wenn jetzt der Lack trocken ist, soll das von den Nazis geraubte Werk zuerst der Kiewer Kunstwelt präsentiert werden, dann darf es nach Dnipro zurück. 79 Jahre später. Das erste und bisher einzige von über 1000 Gemälden aus dem Dniproer Museum, die von den Deutschen gestohlen wurden.
Massenmord und organisierter Kunstraub
Wenn von Kunstraubzügen der Nazis in Osteuropa gesprochen wird, sind oft nur die russischen Verluste gemeint. Dabei war der Aderlass in der heutigen Ukraine weitaus größer, sagt der Bremer Beutekunstexperte Wolfgang Eichwede, der seit Jahrzehnten die Restitution zwischen den Ländern erforscht und auch oft vermittelt hat.
„Nach allen Zählungen, die in der Sowjetunion vorgenommen wurden, und nach allen Angaben, die wir von den deutschen Akten machen können, sind über den Daumen gepeilt, also schätzungsweise, zwei Drittel aller sowjetischen Kulturverluste ukrainische Verluste.“
Als die Wehrmacht am 22. Juni 1941 die Sowjetunion überfiel, sollten die deutschen Einheiten zunächst nach Moskau vordringen. Doch dann entschied Hitler, erst die gesamte Ukraine zu besetzen. Am 19. September nahm die 6. Armee der Wehrmacht Kiew ein und lieferte sich eine tagelange Kesselschlacht mit der Roten Armee. Die hatte das Stadtzentrum vermint, Gebäude, die den Deutschen nicht in die Hände fallen sollten.
Etliche Minen explodierten und lösten einen Großbrand aus. Die Schlacht um die ukrainische Hauptstadt kostete 600.000 Menschenleben, doch das Töten ging weiter. Am 29. und 30. September beorderten die Besatzer alle jüdischen Männer, Frauen und Kinder nach Babyn Jar, die dort erschossen wurden. Über 33.000 Personen.
Posthume Erforschung des Feindes als Mission
Den kämpfenden und mordenden deutschen Einheiten folgten die Kunsträuber. Die Nationalsozialisten waren gekommen, um zu bleiben. Auf ukrainischem Territorium sollte sogenannter Lebensraum für 15 bis 20 Millionen Deutsche geschaffen werden. Zum Reichsminister für die besetzten Ostgebiete ernannte Diktator Adolf Hitler Alfred Rosenberg.
Beide kannten sich seit 1919. Rosenberg war Deutschbalte, dessen Muttersprache somit Russisch war. Er hegte seit der Oktoberrevolution einen tiefen Hass auf die Sowjetunion. In Juden und Bolschewisten sah er die wichtigsten Feinde des deutschen Volkes.
Zitator: „Im Osten leben noch etwa sechs Millionen Juden. Die Judenfrage ist für Deutschland erst gelöst, wenn der letzte Jude das deutsche Territorium verlassen hat und für Europa, wenn kein Jude mehr bis zum Ural auf dem europäischen Kontinent steht.“
Rosenberg war Hitlers wichtigster rassistischer und antisemitischer Vordenker. Seine Mission war die posthume Erforschung des Feindes, für die der Chefideologe eine sogenannte Hohe Schule gründen wollte. Für sie ließ er Bücher und Dokumente in ganz Osteuropa zusammenstehlen.
„Alles, was geeignet ist, das bolschewistische Leben in der Sowjetunion anschaulich zu schildern, sollte direkt nach Berlin gehen“, hieß es aus dem Einsatzstab. Seit 1936 hatte Rosenberg Hitler wegen der Parteischule schon in den Ohren gelegen, nun sollte sie nach dem Krieg aufgebaut werden. Um die insgesamt 17 geplanten Institute der Hohen Schule auszustatten, begann ein Raubzug ungeahnten Ausmaßes, für den sich Rosenberg zahlreiche Spezialisten an seine Seite holte: Archivare, Bibliothekare, Historiker und Archäologen.
Nichts war vor den Deutschen sicher
In Dneprpetrowsk, dem heutigen Dnipro, das sich ab dem 25. August 1941 in deutscher Hand befand, staunte man in den Instituten, Hochschulen, Betrieben, Parteiorganisationen, Archiven und Museen sehr, wie akribisch die Deutschen zunächst die Bestandslisten der Institutionen durchforsteten.
„Als die Stadt besetzt war, kam aus Deutschland eine Expertenkommission.“
„Als die Stadt besetzt war, kam aus Deutschland eine Expertenkommission.“
Sagt Valentina Sazuta vom Historischen Nationalen Museum in Dnipro, in dem sie schon über 45 Jahre arbeitet.
„Die Deutschen schlossen das Museum für Besucher und die Spezialisten begannen sehr gründlich, die Inventarbücher zu studieren. Sie verglichen die Listen und kontrollierten, was nach der Evakuierung durch die sowjetischen Behörden noch vorhanden war. Und später stellte sich heraus, dass sie einen großen Teil der archäologischen Sammlung und auch Gemälde nach Deutschland gebracht haben.“
„Die Deutschen schlossen das Museum für Besucher und die Spezialisten begannen sehr gründlich, die Inventarbücher zu studieren. Sie verglichen die Listen und kontrollierten, was nach der Evakuierung durch die sowjetischen Behörden noch vorhanden war. Und später stellte sich heraus, dass sie einen großen Teil der archäologischen Sammlung und auch Gemälde nach Deutschland gebracht haben.“
Die ukrainische Historikerin Tetjana Sebta hat sich auf die Erforschung der Nazi-Raubzüge spezialisiert. Bücher, Plakate, Filme und Berge von Akten – nichts war vor den Deutschen sicher.
„Sie studierten die kommunistische bolschewistische Ideologie, die Propaganda. Sie wollten wissen, wie das in die Praxis umgesetzt wurde, in der Medizin oder Landwirtschaft der Sowjetunion. Was hatte es auf sich mit den Kolchosen? Es ging darum, wie die Sowjetunion aufgebaut war.“

Die Museumshistorikerinnen in Dnipro suchen seit Jahrzehnten nach geraubter Kunst
So sollte das Institut zur Erforschung der Judenfrage in Frankfurt, ein Ableger der Hohen Schule, eine eigene Bibliothek hauptsächlich mit jüdischer Literatur bekommen, darunter massenhaft Schriften aus Kiew. Rosenbergs Einsatzstab packte trotz der ungeheuren Mengen dennoch nicht wahllos alles ein, erklärt Julia Pischanska, die Direktorin des Historischen Museums von Dnipro.
„Die Deutschen nahmen mit, was einen Bezug zur deutschen Kultur hatte. Das Denkmal von Katharina der Großen zum Beispiel. Es stellte eine Deutsche dar und der Bildhauer war ein Deutscher, somit war es eine Art Leuchtturm für deutsche Kunst. Auch bei den Ausgrabungen ging es um Deutschtum. Dass auf dem Gebiet um Dnipro Goten lebten, war für hiesige Archäologen nichts Neues, aber für die Deutschen. Ein Beweis, dass hier Arier gelebt haben und sie ein Anrecht auf diese Gebiete hätten.“
Von dem imposanten mehrere Meter großen Katharina-Denkmal fehlt jede Spur. Ein Verlust, den die ukrainischen Museumsmitarbeiterinnen, anders als bei sehr vielen anderen Exponaten, zu verschmerzen scheinen. Wohl, so ist die Direktorin zu verstehen, weil Katharina die Große Russland repräsentiert, das im nahen Donbass Krieg gegen die Ukraine führt.
„Die Russische Föderation geht heute bei der Okkupation ähnlich vor. Es werden Anzeichen dafür gesucht, dass hier Russen lebten. Nicht slawische Völker, sondern eben genau Russen. Zugleich wird behauptet, dass Ukrainer nie existierten. Dieses unwissenschaftliche ideologische und fanatische Vorgehen ist typisch für totalitäre Diktaturen, die Besetzungskriege führen. Sie suchen eine Rechtfertigung, weil ein Befreiungskrieg besser als ein Besatzungskrieg klingt. “

Wo einst das Katharinen-Denkmal in Dnipro stand, befinden sich heute am Historischen Museum archäologische Figuren.
Oksana Rudkowskaja, die Museumsarchäologin, zeigt auf den alten Standort des Katharinen-Denkmals.
„Zuletzt stand es hier rechts neben dem Museum und dann war es fort. Katarina die Große ist seit 80 Jahren verschwunden. Jetzt stehen hier 49 Steinfiguren, 38 von dem Kiptschaken aus dem 9. bis 13. Jahrhundert und von den Skythen aus dem 5. oder 6. Jahrhundert vor Christus.“
„Zuletzt stand es hier rechts neben dem Museum und dann war es fort. Katarina die Große ist seit 80 Jahren verschwunden. Jetzt stehen hier 49 Steinfiguren, 38 von dem Kiptschaken aus dem 9. bis 13. Jahrhundert und von den Skythen aus dem 5. oder 6. Jahrhundert vor Christus.“
Auch diese archäologischen Kostbarkeiten hätten bei den Nazis große Begehrlichkeiten geweckt. Die Statuen wurden in oder auf Hügelgräbern gefunden, sogenannten Kurganen, die oft reich bestückt sind. Mindestens 15.000 verteilen sich über die meist flache Landschaft der Ostukraine. Weil die Hohe Schule der Nazis auch ein Institut für nordisch-germanische Geschichte des Ostraumes bekommen sollte, war das Gebiet um Dneprpetrowsk von besonderem Interesse für Rosenbergs Einsatzstab.
Und nicht nur für ihn, denn der Nazi-Ideologe hatte Konkurrenz. Etwa in Gestalt des Reichsführers der SS, Heinrich Himmler, der seine Leute mit der 1935 gegründeten Forschungs- und Lehrgemeinschaft „Ahnenerbe“ auf Ausgrabungen an den Fluss Dnepr schickte. Oksana Rudkowskaja vom Historischen Museum im ukrainischen Dnipro findet die selektive Fixierung der Nazi-Archäologen auf angebliche deutsche Spuren auch aus wissenschaftlicher Sicht äußerst befremdlich.
„Diese ganze Goten-Romantik ließ ihnen keine Ruhe. Und sie suchten so etwas wie eine Hauptstadt. Aber es gibt hier keine solche Goten-Hauptstadt. Dafür jede Menge archäologische Denkmäler, die heute noch unberührt im Boden sind. Noch immer sind Expeditionen mit Ausgrabungen beschäftigt.“
Zahlreiche Stämme haben Zeugnisse hinterlassen
Während der Völkerwanderung 300 bis 600 Jahre nach Christus vermischten sich sehr viele Stämme in der Region, alle hätten zahlreiche Zeugnisse hinterlassen. Auch die Skythen, die schon vor gut 2000 Jahren in der Südukraine lebten, die die Nazis ebenfalls als frühe Vorfahren betrachteten, wie später die Goten.
„Dies sind protoarische, also vor-arische und arische Kulturen. Ich zeige sie Ihnen. Hier ist ein Querschnitt eines Hügelgrabes. In einem wurde ein Kind gefunden, unklar, ob Junge oder Mädchen. Und hier kommen die Goten. Dies ist eine Darstellung eines toten Kriegers, die Ikonografie ist erhalten: Kriegerfrisur, lange Haare, Zöpfe und abgeschnittene Nase“, sagt Oksana Rudkowskaja.
Die Nazi-Expeditionen mussten ortskundige Wissenschaftler begleiten. Der ukrainische Direktor des Museums von Dneprpetrowsk, Pawel Kosar, wurde zu einer dreiwöchigen Ausgrabungstour verdonnert, was ihm später jede Menge Ärger einbrachte, erläutert die Dienstälteste des Museums, Valentina Sazuta.
„Kosar nahm teil, weil er selbst Archäologe war. Nach dem Krieg beschuldigte ihn die Sowjetmacht des Nationalismus und, ein Bourgeois zu sein. Er verschwand aus dem Museum und wurde politisch verfolgt, weil er mit den Besatzern zusammengearbeitet hatte.“

Nur einen Teil der Sammlung konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor den Nazis verstecken, sagt Mueseumsdirektorin Kateryna Tschujewa.
Das Museum für westliche und östliche Kunst in Kiew war die drittwichtigste Sammlung der Sowjetunion, nach der Tretjakow-Galerie in Moskau und der Eremitage. Dem Gründer- und Sammlerehepaar Bogdan und Warwara Chanenko zu Ehren wird es heute noch Chanenko-Museum genannt. Untergebracht ist es in deren Villa, ein wohnlicher, im italienischen Stil erbauter Stadtpalast. Die Direktorin, Katerina Tschujewa, eine junge Frau mit asymmetrischem Haarschnitt, über das traurigste Kapitel des Hauses:
„Einen Teil der Sammlung konnten die Mitarbeiter vor den Nazis verstecken. Die Besatzer nahmen sich aus dem Bestand, was sie später nach Deutschland schickten, und womit sie ihre Verwaltungsräume und Dienstwohnungen in Kiew dekorieren wollten. Das dokumentierten sie in Listen, die noch in unseren Archiven zu finden sind.“
Nichts war vor den deutschen Marodeuren sicher. Sie bedienten sich auch privat, viele Bilder sind bis heute verschollen, vermutlich hängen sie in deutschen Wohnzimmern. Die ukrainische Beutekunst-Expertin Tetjana Sebta nennt die größten Diebe.
„Der Reichskommissar für die Ukraine, Erich Koch, stahl zum Beispiel 16 Bilder aus dem Chanenko-Museum und ein Bild aus dem Russischen Museum mit dem Titel „Mädchen in roter Tracht“. Die allermeisten Bilder nahm Generalkommissar Waldemar Magunia mit. 48! 27 sind wiederaufgetaucht, 21 fehlen noch immer.“
Museumsmitarbeiter suchen bis heute Kunstwerke
Viele Schätze sind zwar während der Kämpfe und auf den Transporten im Krieg zerstört worden, doch immer wieder werden welche zum Kauf angeboten. Deswegen sind viele ukrainische Museumsmitarbeiter bis heute wachsam, auch Katerina Tschujewa vom Chanenko-Museum.
„1943 gingen die Transporte los. Angeblich seien die Exponate in einem Schloss bei Königsberg verbrannt, aber ob das geschah und wie viele tatsächlich vernichtet wurden, ist bis heute unklar. In den Verlustlisten nach dem Krieg sind 25.000 Kunstwerke aufgeführt, darunter 20.000 Kupferstiche, unter anderem von Rembrandt und Dürer. Und uns fehlen 450 Gemälde. Unser Museum sucht bis heute diese Arbeiten.“
Nach dem Krieg lagerten in den ausgeraubten Kiewer Museumsräumen zwischenzeitlich fast 100.000 Werke der Dresdener Gemälde-Galerie. Die sowjetische Trophäenbrigade hatten Kunst vor allem in Ostdeutschland als Entschädigung für ihre zuvor erlittenen Verluste in der Sowjetunion konfisziert.
Die Gemäldegalerie bekam ihre Bilder von 1950 an zurück. Eine Geste der UdSSR an den Bruderstaat DDR. Für das Chanenko-Museum verlief die Rückgabe sehr viel schleppender. Bis heute sind erst vier Bilder zurückgekehrt, zwei davon hat Olena Schiwkowa auf internationalen Auktionen entdeckt, wie sie am Telefon aus dem Urlaub erzählt.
„Vorher war Beobachtung der Auktionen lediglich ein Hobby, jetzt ist es Teil meiner Arbeit. Ich schaue monatlich die Kataloge der Auktionshäuser durch. Alle Gemälde, die wir vermissen, habe ich im Kopf. Zusätzlich haben wir von 474 Arbeiten Schwarz-Weiß-Fotografien. Es gibt unzählig viele Bilder, die sich ähneln. Aber ich weiß ganz genau, wie zum Beispiel unser Venedig-Gemälde aussieht, und weiß damit sehr genau, was ich suche.“
Neue Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg
Wonach das Museum fahndet, hat es auf die Lost-art-Liste gestellt, ein Online-Verzeichnis für vermisste Kunstwerke. Im Februar 2014 wurden bei vielen ukrainischen Kunstliebhaber urplötzlich Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg wach, sagt Olena Schwikowa. Als Russland die Krim annektierte.
„Es gibt so ein Sprichwort: Hoffe auf das Beste, aber nimm das Schlimmste an. 2014 haben wir überlegt, ob wir evakuieren, denn es war absolut nicht klar, was der russische Präsident Putin mit unserem Land vorhatte. Aber aus dem Zweiten Weltkrieg wissen wir, dass die Schäden durch Transporte an Plätze, die nicht geeignet sind für die Lagerung von Kunstschätzen, im Zweifel noch verheerender sein können. Wir fanden es besser, die Bilder in unsere Keller zu bringen.“
„Es gibt so ein Sprichwort: Hoffe auf das Beste, aber nimm das Schlimmste an. 2014 haben wir überlegt, ob wir evakuieren, denn es war absolut nicht klar, was der russische Präsident Putin mit unserem Land vorhatte. Aber aus dem Zweiten Weltkrieg wissen wir, dass die Schäden durch Transporte an Plätze, die nicht geeignet sind für die Lagerung von Kunstschätzen, im Zweifel noch verheerender sein können. Wir fanden es besser, die Bilder in unsere Keller zu bringen.“
Neben dem Einsatzstab Rosenberg, dem „Ahnenerbe“ von der SS und dem sogenannten Kunstschutz von der Wehrmacht war auch das Einsatzkommando Künsberg vom Auswärtigen Amt des „Dritten Reiches“ hinter Kunst und Büchern her, vor allem aber hinter Urkunden und Kartenmaterial.
„Freiherr von Künsberg, das war der, der das initiiert hat. Eine ganz windige Gestalt. Wirklich ein Taschenspieler, der sich da im Auswärtigen Amt irgendwie Freunde gemacht hat und für den geografischen Dienst des Auswärtigen Amtes den Auftrag hatte, in besetzten Gebieten Materialien sicherzustellen.“
Sagt die Osteuropa-Historikerin Corinna Kuhr-Korolev vom Potsdamer Zentrum für Zeithistorische Forschung. Denn dieses Künsberg-Kommando hatte 1941 in Kiew die Wernadski-Bibliothek samt Handschriftenabteilung beschlagnahmt, darunter ein Original-Schriftstück von Zar Peter dem Ersten. Diese Zarenurkunde hing seit Ende der 1950er-Jahre in der Universität Tübingen, doch erst über 70 Jahre später, ab 2014, fragte man sich dort, was es mit der Urkunde auf sich hat.
Sagt die Osteuropa-Historikerin Corinna Kuhr-Korolev vom Potsdamer Zentrum für Zeithistorische Forschung. Denn dieses Künsberg-Kommando hatte 1941 in Kiew die Wernadski-Bibliothek samt Handschriftenabteilung beschlagnahmt, darunter ein Original-Schriftstück von Zar Peter dem Ersten. Diese Zarenurkunde hing seit Ende der 1950er-Jahre in der Universität Tübingen, doch erst über 70 Jahre später, ab 2014, fragte man sich dort, was es mit der Urkunde auf sich hat.
„Es war auch allen bewusst, dass sich um ein Original handelt, dass sie eigentlich nicht dahin gehört, und trotzdem hat es bei niemandem so richtig klick gemacht: Das müssen wir jetzt zurückgeben. Insofern war das keine Entdeckung, sondern es war eigentlich nur eine Neu-Überlegung und noch mal der Anstoß: Wir müssen der Sache noch einmal nachgehen.“

Die Zarenurkunde, heute wieder in der Wernadskij-Bibliothek in Kiew, hing lange in der Universität Tübingen.
Das imposante Pergament von anderthalb Metern Größe bekam während des Konfliktes mit Russland eine neue kirchenpolitische Bedeutung. Denn das Schriftstück bestätigt die Einsetzung des Metropoliten, also eines Vertreters der Moskauer orthodoxen Kirche in Kiew.
„Von 1708 ist die Urkunde mit einem handtellergroßen Wachswappen des Zaren. Supertoll erhalten, wie neu eigentlich. Und diese Urkunde ist politisch ein kleines bisschen heikel, weil darin dieser Metropolit noch mal betont, dass er sich wirklich dem Moskauer Patriarchat unterordnet und eben nicht nach Byzanz ausrichtet. Und genau diese Passage, in der das ausgeführt wird, die fehlt in einer Abschrift.
Insofern war das die Rückgabe eines schönen Kunstwerks und kulturhistorisch wichtigen Zeugnisses, das wirklich nach Kiew gehört. Interessant eben auch mit dieser Passage, die man deuten kann, da hat sich die Kiewer Kirche noch mal explizit dem Moskauer Patriarchat unterstellt. Oder umgekehrt die Moskauer wollten sich dieser Unterstellung noch mal versichern.“
Wenig Begeisterung in der Ukraine
2019 gab die Tübinger Universität die Zarenurkunde fast unbemerkt an die Kiewer Wernadski-Bibliothek zurück. In der Ukraine hielt sich der Jubel trotzdem in Grenzen, auch weil der deutsch-ukrainische Restitutionsdialog eine einzige Enttäuschung für die Ukrainer ist. Das hätte auch an den Erwartungen gelegen, die 1993 als der Dialog begann, viel zu groß waren, sagt der Historiker Sergej Kot, der damals Mitglied der ukrainisch-deutschen Restitutionskommission ist.
„Wir waren Idealisten, als wir den Dialog begonnen haben. Wir dachten, wenn wir Sachen zurückgeben, dann tut Deutschland das auch. Denn dort liegt alles, was wir vermissen. Stattdessen kamen nur einzelne Stücke zurück. Praktisch nichts, im Vergleich zu den Verlusten der Ukraine.“
Ein Vorwurf, den der Historiker auf die aktuelle Diskussion bezieht, nicht aber auf die umfangreichen Rückgaben direkt nach dem Krieg. Riesige Mengen des Raubgutes hatten die Nazis zwischengelagert. Die US-Truppen führten diese Depots an sogenannten Collecting Points zusammen und schickten bis 1948 über einer halben Million Objekte wieder in die Sowjetunion zurück.
Wolfgang Eichwede, wohl der erfahrenste Restitutionsexperte in Deutschland, muss den deutschen Museen darum glauben, wenn sie sagen, dass sie keine Raubkunst aus der Ukraine haben.
„Wahrscheinlich ist in öffentlichen Beständen wenig bis gar nichts. Deshalb, weil die NS-Stäbe, die in der Sowjetunion geklaut haben, ihre Güter ja nicht verteilt haben bis zum Ende des Krieges an Museen, sondern weil sie eben in den Depots geblieben sind.“
„Wahrscheinlich ist in öffentlichen Beständen wenig bis gar nichts. Deshalb, weil die NS-Stäbe, die in der Sowjetunion geklaut haben, ihre Güter ja nicht verteilt haben bis zum Ende des Krieges an Museen, sondern weil sie eben in den Depots geblieben sind.“
In privaten Händen dürfte sich dagegen noch vieles befinden, was die Großväter im Krieg mitgenommen haben. Wie das Zaren-Gemälde aus Dneprpetrowsk. Deutsche Familien müssten mal in ihren Wohnzimmern nachsehen und sich dann von dem einen oder anderen Kunstwerk des Vaters oder Großvaters trennen.
© website copyright Central Registry 2024