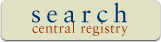Die Welt 14 December 2010
Berlins Nationalgalerie zeigt in einer Ausstellung Gemälde, die als verschollen galten und nun wieder zurückgekehrt sind.
Frühstück mit Menzel? Adolf Hitler hatte ein Faible für den Berliner Maler, Schinkel und Ahlborn. Sorgsam sind die einzelnen Gemäldetitel per Schreibmaschine im „Verzeichnis der an die Reichskanzlei ausgeliehenen Kunstwerke“ aufgelistet. Datum: 1934. „In der Wohnung des Führers“ hingen unter anderen Menzels „Hofgastein“ und Schinkels „Gotischer Dom am Fluss“. Ein roter Haken bestätigte deren Eingang. Auch Ahlborns idyllischer „Blick auf Florenz“ von 1832 dekorierte Hitlers Heim. Seit 1945 galt das Gemälde als verschollen. Über sechzig Jahre später wurde es 2009 – aus Privatbesitz – in einem Berliner Auktionshaus angeboten, ein Sammler informierte die Experten der Nationalgalerie. In diesem Frühjahr ging es an das Museum zurück – und wird nun erstmals frisch renoviert und von Knicken befreit in einer Kabinettausstellung dort gezeigt.
Die Schließung Mit dem 1. September 1939 begann für die Nationalgalerie mit ihren ständigen Ein- und Auslagerungen der Kunstwerke eine Odyssee. Die Gemälde wurden zuerst in den sicheren Keller transportiert. Im Laufe des Krieges kamen sie teilweise in die Reichsbank am Werderschen Markt, den Flakbunker Zoo und Friedrichshain. Im März ’45 schließlich transportierte man die Kunstschätze in stillgelegte Salzbergwerke. Auch Leihgaben an die deutschen Botschaften in Rom oder Helsinki mussten als Verlust verbucht werden.
„Florenz“ ist eines von 18 bis dahin als verschollen geglaubten Gemälden aus dem Vorkriegsbestand der Alten Nationalgalerie in Berlin, die in den letzten Jahren überraschend in Privatbesitz aufgetaucht sind und für das Haus auf der Museumsinsel zurückgewonnen werden konnten. Die Dunkelzone ist groß, nach zahlreichen Ein- und Umlagerungen in den Flakbunkern Zoo und Friedrichshain weiß bis heute niemand genau, welche Werke verbrannten oder gestohlen wurden. Die Bewachung war damals nicht lückenlos, der Brand in Friedrichshain mysteriös.
800 Werke fehlen im Bestand der Nationalgalerie. Jeder „Rückkehrer“ hat eine eigene, teilweise abenteuerliche Geschichte. Der reichlich ramponierte „Dichter Klaus Groth“ von Christian Ludwig Bokelmann verschwand 1945 aus dem Flakturm Friedrichshain und tauchte vor fünf Jahren auf einem Berliner Flohmarkt wieder auf. James William Coles „Hund mit Schimmel“ war als Leihgabe über das Auswärtige Amt an die Dienstvilla des im Exil lebenden irakischen Ministerpräsidenten in Dahlem verliehen worden. Später gelangte es – als Lohn – an ehemalige Hausangestellte in Sachsen. Einer der Erben recherchierte die Herkunft, so gelangte es nach Berlin zurück.
Diese Bilder liebte der Diktator

- Foto: picture-alliance / akg-images Der Diktator Adolf Hitler verehrte die Künstler des 19. Jahrhunderts. Arnold Böcklins "Toteninsel" (1883) hing in der Reichskanzlei.

- Foto: picture-alliance / akg-images/akg Ein Bild Friedrich des Großen von Anton Graff diente dem greisenhaft wirkenden Hitler zum stummen Zwiegespräch.

- Foto: picture-alliance / akg-images Adolph Menzels "Friedrich der Große auf Reisen" (1854) hing in Hitlers Arbeitszimmer.

- Foto: picture-alliance / akg-images/akg Dort befand sich auch Carl Spitzwegs "Ständchen" (1838).

- Foto: picture-alliance / akg-images/akg Eine "Nanna" (1861) von Anselm Feuerbach konnte man im Berghof besichtigen.

- Foto: picture-alliance / akg-images Feuerbachs "Das Gastmahl des Plato" gefiel Hitler zwar, doch wegen der homoerotischen Andeutungen durfte es nicht im Festsaal des Reichskanzlerpalais aufgehängt werden.
Udo Kittelmann, Chef der Nationalgalerie, möchte diese Ausstellung museumspolitisch verstanden wissen. „Wir stellen uns damit der Geschichte der Sammlung und machen sie transparent.“ Auch die laufende Schau der Neuen Nationalgalerie „Moderne Zeiten“ widmet sich der Sammlungsgeschichte und zeigt mit der „Schattengalerie“ auf, welche Bilder durch die Naziherrschaft verlustig sind. Mittlerweile gibt es sieben Bände, die die „Dokumentation der Verluste“ in den einzelnen Häusern der Staatlichen Museen umfassen. Der Verlustkatalog der Nationalgalerie stammt aus dem Jahr 2001. In der Alten Nationalgalerie selbst hängt inmitten der Schau symbolisch ein leerer Rahmen, einst für ein Gemälde von Carl Blechen gefertigt. „Botschaft und Hoffnung, dass er sich einmal wieder füllen wird“, so Kittelmann.
Doch warum erst jetzt diese Ausstellung? Für die Berliner Museen war es bis 1990 nicht möglich, die fehlenden Werke nach dem Krieg hinreichend zu dokumentieren. Die Teilung der Sammlungen in Ost und West und das von den DDR-Funktionären erwirkte Kontaktverbot unter Wissenschaftlern machte eine wirkliche Inventarisierung nicht möglich. Eine vollständige Übersicht fehlt allerdings bis heute, so Kuratorin Birgit Verwiebe. In den letzten zehn bis zwanzig Jahren registrieren die Staatlichen Museen eine „stetig steigende Kurve der rückkehrenden Gemälde, mehr als in all den Nachkriegsjahrzehnten davor“, sagt Michael Eissenhauer, Generaldirektor der Staatlichen Museen.
Görings gestohlene Sammlung

- Foto: picture-alliance / KPA/TopFoto/KPA Hermann Wilhelm Göring (1893-1946) war nach Hitler die Nummer Zwei in der Hierarchie des Dritten Reiches. Er befehligte die Luftwaffe und war designierter Nachfolger des "Führers". Auf einen Befehl von ihm begann der systematische Völkermord an den Juden.

- Foto: picture-alliance / maxppp/picture-alliance / ©Selva/Leemag Der "Führer" Adolf Hitler (l.) sammelte Kunst, aber auch Göring tat dies.

- Foto: Archiv Tausende von Kunstwerken ließ sich Göring zusammenstehlen. Darunter: Lucas Cranachs "Muttergottes mit Jesus und Johannes dem Täufer" von 1512. Nach dem Krieg gelangte es wieder in die Hände von Görings Lieblingskunsthändler Walter Andreas Hofer. Der verkaufte das Gemälde an den Kölner Juristen Robert Ellscheid. Dessen Enkel hat es nun bei Sotheby's eingeliefert.

- Foto: picture-alliance / dpa/Galerie_Stangl/ART Franz Marcs „Turm der blauen Pferde“ von 1913 war ebenfalls in Görings Besitz. Zuletzt nach Kriegsende sahen glaubwürdige Zeitzeugen das Bild in Berlin-Zehlendorf, doch seitdem ist es verschollen.

- Foto: Reproduktion/Wikimedia Von van Goghs "Liebespaar", das die Berliner Nationalgalerie 1929 erwarb, gibt es nicht einmal eine Farbabbildung. Göring ließ es für sich beschlagnahmen.

- Foto: picture-alliance / akg-images/akg Auguste Renoirs Porträt der Irène Cahen d'Anvers stahlen Görings Kunstjäger aus dem Besitz der Familie der dargestellten Bankierstochter. Nach dem Krieg wurde es restituiert und schließlich an den Zürcher Sammler Emil Georg Bührle verkauft.

- Foto: picture-alliance / dpa/Christies Vincent van Goghs "Portrait des Dr. Gachet" ließ Hermann Göring aus dem Frankfurter Städel beschlagnahmen und verkaufen. 1990 wurde es mit einem Auktionspreis von 82,5 Millionen Dollar zum bis dato teuersten Kunstwerk aller Zeiten.

- Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb/PA_FILES Van Goghs berühmte "Zugbrücke in Arles" kam in Görings Besitz aus der beschlagnahmten Sammlung der französischen Bankiersdynastie Rothschild.

- Foto: picture-alliance/ dpa/dpa Auch das "Bildnis eines bärtigen Mannes" von Giovanni Domenico Tiepolo aus dem 18. Jahrhundert war in Görings Sammlung.

- Foto: Reto Klar Die Suche nach Görings Meisterwerken lässt ihn nicht mehr los: Roland März, Kunsthistoriker.

- Foto: picture alliance / dpa/dpa Zu Görings Schätzen zählte auch ein vermeintliches Meisterwerk von Jan Vermeer. Tatsächlich aber stammte das Bild "Christus und die Jünger in Emmaus" von Han van Meegeren.

- Foto: picture alliance / dpa/dpa Han van Meegeren war fast so gut wie Jan Vermeer selbst, zugleich dreist und kaltblütig. Kein anderer hat den weltberühmten Barockmeister aus Delft besser gefälscht. Der Direktor des Museums Boijmans Van Beuningen, Dirk Hannema (vorn), und Restaurator Hendrik Luitwieler betrachteten 1938 das angebliche Vermeer-Gemälde "Christus und die Jünger von Emmaus", dem Göring auf den Leim ging.

- Foto: picture-alliance / Mary Evans Pi/Mary Evans Picture Library Göring ließ sich auch selbst von den Malern des Regimes feiern: Szene mit seiner Entourage im Reichsluftfahrtministerium in Berlin.

- Foto: picture-alliance / Judaica-Samml/Judaica-Sammlung Richter In seinem Jagdsitz Carinhall in der Schorfheide nördlich von Berlin waren zahlreiche Bilder aus seinen Raubzügen ausgestellt. 1945 ließ Göring - hier bei einem Staatsempfang 1941 - sein Anwesen sprengen.
Für die Rückgewinnung der Kunstwerke aus Privatbesitz hat man in Berlin ein „relativ gut funktionierendes System entwickelt“, glaubt Justiziarin Dorothea Kathmann. „Wir führen weniger einen Rechtsstreit, sondern haben es geschafft, sehr, sehr gute Verhandlungspositionen aufzubauen.“ Eine wichtige Hilfe und starker Partner sind dabei die Auktionshäuser geworden. Anders noch als vor Jahren ist es mittlerweile so, dass der Kunsthandel eine Art Ehrenkodex entwickelt hat und direkt an die Museen herantritt, wenn ein Werk vermutlich aus deren Besitz stammt. Kurz: Bevor eine Provenienz nicht restlos geklärt ist, geht dort nichts mehr unter den Hammer. Institutionen wie das Art Loss Register in London und die Lost Art Datenbank in Magdeburg kooperieren längst mit den Riesen der Branche wie Sotheby’s und Christie’s. Es hat dort wenig Sinn, mit jenen Werken zu handeln, die eigentlich in den Besitz eines Museums gehören.
Allerdings ist für den heutigen Besitzer die Rückgabe wenig lukrativ, lediglich zehn Prozent des Marktpreises gelten als „Finderlohn“. Werke aus dem ehemaligen Bestand der Preußischen Sammlungen können juristisch gesehen nicht noch einmal erworben werden. Der Nachweis als Museumseigentum sei relativ einfach dank einer „sehr guten Vorkriegskartei“ mit Fotos, die die Identifikation erleichtern. Und so ließen sich die Verkäufer, so die Erfahrung von Dorothea Kathmann, „relativ bereitwillig auf Vertragslösungen ein“. Hoffnung also für die Justiziarin, dass „wir künftig noch mehr Rückkehrer haben werden“.
http://www.welt.de/kultur/history/article11524364/Diese-Bilder-schmueckten-auch-Hitlers-Reichskanzlei.html